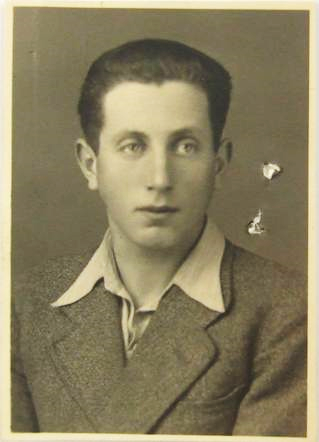
Gustav Simon
*15.1.1920 in Bisses, Echzell; ✡ 2.4.1943 in Sobibor
Staatsangehörigkeit deutsch
Religion jüdisch
Vater Julius Simon *12.5.1891 in Bisses; ✡1.10.1944 in Auschwitz

Heirat der Eltern 20.3.1919 in Echzell
Mutter Milli Simon geb. Simon *28.1.1896 in Echzell; ✡ 9.10.1944 in Auschwitz
Großeltern (Vater) Levi Simon und Sahra Seligmann
Großvater Adolf Abraham Simon *24.3.1873 in Echzell; ✡ 19.5.1944 in Auschwitz
Großmutter Kathinka Gretchen Grünewald *4.8.1864; ✡8.8.1927 in Gettenau
Stiefgroßmutter Lina Simon geb. Levy *3.2.1893 in Rodheim; ✡19.5.1944 in Auschwitz
Onkel
Adolf Simon *4.12.1887 in Bisses; ✡vor 1945 in Polen; oo Frieda Adler *15.1.1892
Gustav Simon *30.3.1890 in Bisses; vermisst im WK-I seit 20.8.1917
Sigmund Simon *12.11.1899 in Echzell; oo Erna Goldschmidt, Bad Orb
Siegfried Simon*12.11.1899 in Echzell; oo 1924 Hertha Langold
Geschwister
Margot Simon *24.10.1922 in Bisses; ✡1942 in Auschwitz
Erich Simon *5.7.1924 in Bisses; ✡1942 in Auschwitz
Cousins
Alfred Simon *3.12.1920 in Bisses; ✡16.7.1942 im KL Majdanek
Lieselotte Simon *21.11.1921 in Echzell; ✡25.11.1941 im Fort IX in Kauen
Beruf landwirtschaftlicher Praktikant
Adressen Bisses, Bahnhofstraße 19; Frankfurt, Körnerwiese 8, Dominikanerplatz 14/16; Steckelsdorf bei Rathenow im Landkreis Jerichow;
Heirat ledig
Kinder –
Weiterer Lebensweg
Den Vornamen Gustav erhielt er nach dem im 1. WK kriegsgefallenen Onkel

Gustav Simon Unteroffizier der 9. Kompanie des Infanterieregiments 168;
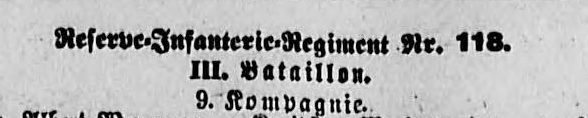
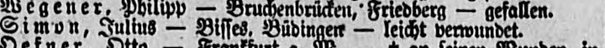
Vater Julius leicht verwundet gemeldet als Soldat der 9. Kompagnie, 3. Bataillondes Reserve-Infanterie-Regiment 118 mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden
Vater Julius Simon führte in der Bahnhofstraße 19 eine Metzgerei, war im Vorstand der israelitischen Gemeinde; Mitbegründer des SV Echzell, lange Jahre im Vorstand und 1931 1. Vorsitzender
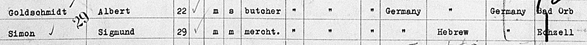
19.-29.4.1929 Onkel Siegmund mit seinem Schwager Albert Goldschmidt auf der SS HAMBURG von Hamburg nach New York
1935 Onkel Siegfried mit Frau Hertha und den Töchtern Marlies und Lieselotte nach Palästina
Dezember 1935 Umzug der Familie Julius Simon von Bisses nach Frankfurt, Körnerwiese 8
Umzug in Frankfurt, Dominikanerplatz 14/16
Vater Julius Angestellter der Jüdischen Gemeinde
Novemberpogrom bei der Familie Simon in Echzell und Bisses
Hermann Heck, damals 12 Jahre berichtet als Augenzeuge am 9.11.2013:
„ … Max (Simon) und seine Frau haben sie aus dem Haus getrieben, dann haben sie Gegenstände auf den Hof und auf die Straße geworfen.“…“ Sie haben das Ehepaar aus dem Haus getrieben, den Mann haben sie geschlagen, die Frau hat furchtbar geschrien, dann sind beide in den Garten geflohen. Dann wurden alle möglichen Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Nachbarsleute haben dann Einhalt geboten: „Das Haus ist verkauft, und wenn ihr hier Schaden anrichtet, wird euch der neue Besitzer haftbar machen.“ Das Wüten war dann zu Ende.“
Novemberpogrom in Frankfurt
Vater Julius Simon im Novemberpogrom in Frankfurt verhaftet
Internierung im KL Buchenwald, Häftlingsnummer 29446
12.12.1938 Entlassung des Vaters aus dem KL Buchenwald
17.5.1939 Gustav in Steckelsdorf bei Minderheiten-Volkszählung
17.5.1939 beide Eltern, Schwester Margot und Bruder Erich in Frankfurt bei Minderheiten-Volkszählung
Das jüdische Umschulungslager Steckelsdorf-Ausbau
1939 Gustav Simon zur Hachschara in das jüdische Umschulungslager Landwerk Steckelsdorf-Ausbau bei Rathenow im Landkreis Jerichow II; Träger ist der Bachad, 1928 gegründete Jugendorganisation des orthodox-jüdischen Misrachi; das hebräische Akronym בָּחָ״ד BaChaD steht für Brit Chaluzim Datiim, deutsch ‚Bund religiöser Pioniere‘; Träger war zuletzt die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland RVJD. Das Anwesen gehörte als Jagdvilla einem Berliner Industriellen, der es einschließlich der dazugehörigen Gärtnerei 1936/37 seiner Jüdischen Gemeinde zur Einrichtung eines Erholungsheims schenkte.
Madrichim 1940 Chaim Grosz und Richard Heymann
10.11.1938 Novemberpogrom in Steckelsdorf, am Abend wurde das Landwerk gestürmt und verwüstet. Alle männlichen Funktionsträger wie Betriebsleiter Werner Hoffbauer, Simon Berlinger, Adolf Frohmann, Friedrich Löwenthal und Herbert Schönewald verhaftet ins Polizeigefängnis Magdeburg und später als „Schutzhäftlinge“ nach Buchenwald gebracht.
21.11.1938 Entlassung der Steckelsdorf Madrichim Simon Berlinger, Adolf Frohmann, Friedrich Löwenthal und Herbert Schönewald aus dem KL Buchenwald
1939 Instandsetzung und Übernahme von Steckelsdorf durch die RVJD
1.9.1939 Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen
21.5.1941 Schließung der Büros des Hechaluz, Palästinaamt und Bachad in der Meinekestraße 10, Wechsel in die Kantstraße 158
Die Schließung des Landwerks
21.5.1942 schriftliche Ankündigung der Schließung für den 24.5.1942
24.5.1942 offizielle Schließung, nur die Stammbelegschaft des Landwerks verbleibt und 15 Zwangsarbeiter der optischen Industrie in Rathenow
1942 Flucht mit Schwester Margot in die Niederlande
Der Kibbuz Laag Keppel bei Hummelo
Der Kibbuz Laag Keppel bei Hummelo befand sich im Wohnhaus „Huis van Aberson“ am Rijksweg.
Er bestand von 1941 bis zur Räumung im März 1943.
Juni 1942 Anweisung an die Bürgermeister der Provinz Gelderland, alle ortsansässigen Juden in Listen zu erfassen
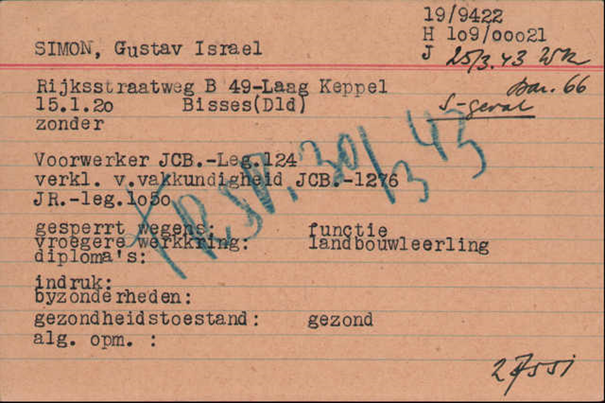
Gustav Simon zunächst gesperrt wegen seiner Funktion als Vorarbeiter in der J.C.B. – vakopleiding (Joodse Centrale voor Beroepsopleiding)
1942 die Chaluzim des Kibbuz Beverwijk kommen hinzu
März 1943 wegen der erwarteten Auflösung des Kibbuz versucht Gustav Simon unterzutauchen.
24.3.1943 Inhaftierung in der Polizeistation in Meppel, nachdem sein Versteck verraten wurde
25.3.1943 Tagesrapport der Gemeindepolizei in Assen
“Vrijdag 25 maart 1943. 16 uur. In tijdelijke bewaring van de SS alhier overgenomen (uit het Huis van Bewaring) en ingesloten aan het bureau de jood: Gustaf Israël Simon, geboren Bisses Dld. 15-1-1920, gedomicilieerd Laag Keppel B. 49. Hij wordt hedenmiddag door het kamp Westerbork afgehaald. Simon heeft geen geld en papieren bij zich. 16. 15 uur. de jood Gustaf Israël Simon door de Marechaussee Lutz van de brigade Westerbork van het bureau afgehaald.”
25.3.1943 Internierung im Judendurchgangslager Westerbork, Unterbringung in der Strafbaracke 66 als „S-geval“ (Strafgefangener)
29.3.1943 Offizielle Ankündigung der „Evakuierung“ des Kibbuz Laag-Keppel
Abschiebung von Gustav Simon auf den nächsten, jeweils dienstags abgehenden Wochentransport
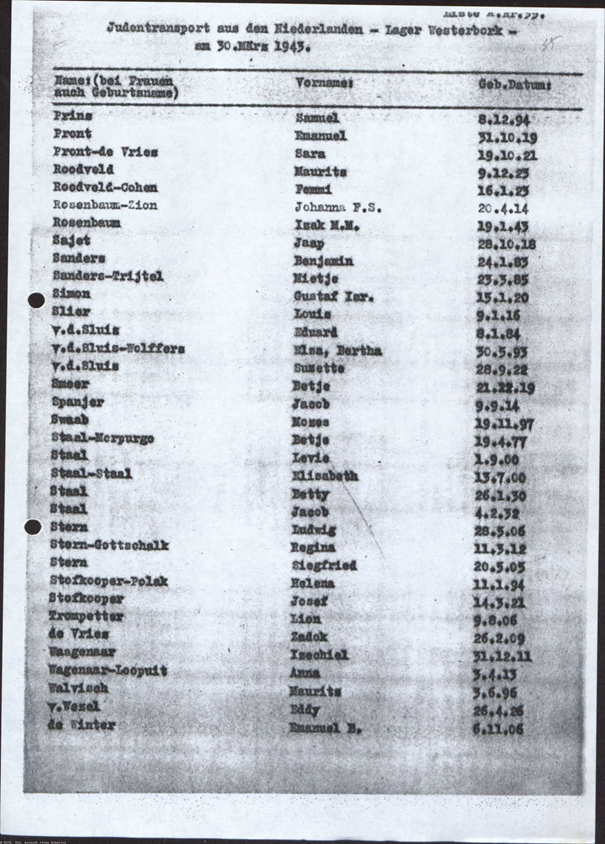
30.3.1943 Deportation ab Westerbork nach Sobibor; auf dieser Straftransport-Liste stehen weitere zur Strafe sofort Deportierten, zumeist aus der Strafbaracke 66
2.4.1943 Tod von Gustav Simon in Sobibor
10.4.1943 Festnahme aller Kibbuzbewohner, Verbringung in das KL Vught
Deportation der Eltern und Großvater nach Theresienstadt und Auschwitz
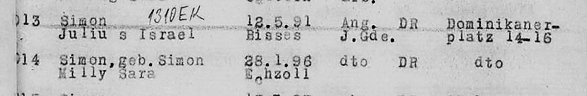
15.9.1942 beide Eltern auf Transport XII/3 ab Frankfurt nach Theresienstadt
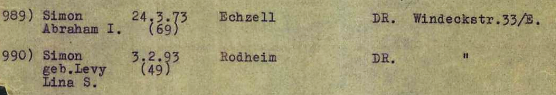
Großvater Adolf Simon mit seiner zweiten Frau Lina auch auf Transport XII/3
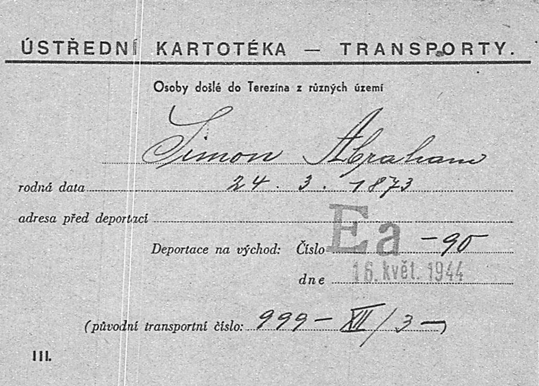
16.5.1943 Großvater Adolf und Lina Simon auf Transport Ea vonTheresienstadt nach Auschwitz
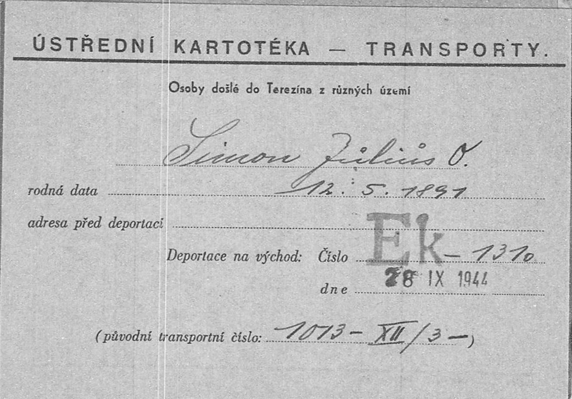
28.9.1944 Vater Julius auf Transport Ek vonTheresienstadt nach Auschwitz
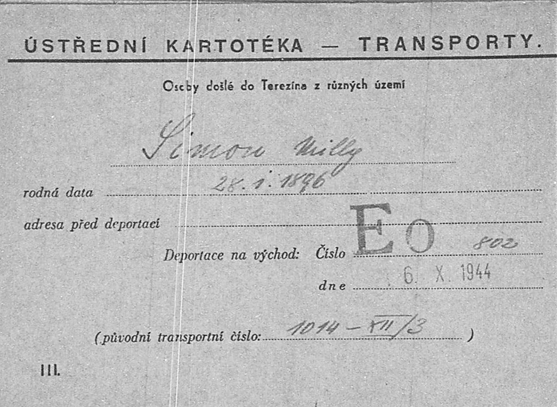
6.10.1944 Mutter Milli auf Transport Eo vonTheresienstadt nach Auschwitz
Massenerschießung im Fort IX in Kauen
22.11.1941 Deportation der Cousine Lieselotte ab Frankfurt nach Kowno (Kauen), Fort IX
29.11.1941 Massenerschießung im Fort IX in Kauen
Gedenken
15.10.1956 Pages of Testimony für Gustav, seine Eltern und Geschwister und Großvater Adolf von Onkel Siegfried Simon
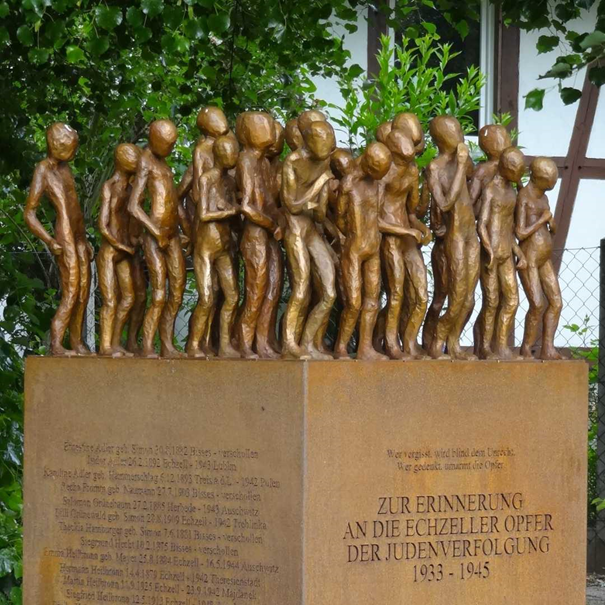
25.4.2013 öffentliche Vorstellung des Mahnmals für die Opfer von Echzell
Quellen
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962102
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de961776
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de961791
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962308
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de962348
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/226580/gustav-simon
http://juedisches-echzell.de/uploads/berichte/echzeller_familien_neu.pdf
Preußische Verlustlisten vom 4.9.1915 und 17.9.1917, Seite 8563 und 20644
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/11200358
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/5081044
Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939
Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947
Einreiselisten Israel
https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf
Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at New York, New York, 1897-1957 (National Archives Microfilm Publication T715, roll 4480); Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85
Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.
<https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]
Ezra BenGershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989
Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328
Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988
Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020