Siegmund Löwenstein
* 28.8.1880 in Bochum; +17.10.1944 in Auschwitz
Staatsangehörigkeit deutsch
Vater Isaak Löwenstein *29.1.1839; Kaufmann; +14.5.1903 in Bochum
Mutter Julie Haase *16.6.1945; +7.2.1917 in Bochum; jüd. Friedhof
Cousin
Julius Löwenstein *15.2.1883 in Bochum; Jurist, Dr. jur.; Theresienstadt;
Beruf Jurist, Dr. jur., Landgerichtsrat
Adressen
Heirat Else Koopmann *18.3.1892 in Duisburg; +30.10.1944 in Auschwitz
Kinder
Werner Löwenstein *30.7.1913 in Bochum; +16.8.1941 im KL Mauthausen
Rudolf Löwenstein *1.7.1916 in Bochum; +4.9.1941 im KL Mauthausen
Lieselotte Hildegard Löwenstein *24.6.1922 in Bochum; oo 1943 in Westerbork Meijer Joseph Cohen (*20.8.1910 +16.4.1945 im Sachsenhausen-Außenlager Schwarzheide); in Auschwitz befreit; +9.6.1953 in Eindhoven
Weiterer Lebensweg
Gymnasium Bochum
Abitur 1901
Jura Studium in Freiburg, Berlin, München, Bonn
2.7.1907 Rigorosum an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg
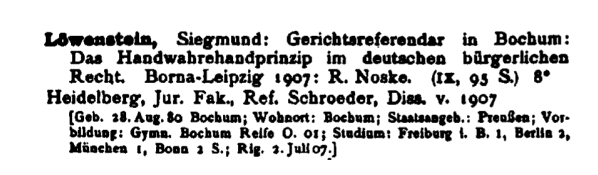
21.12.1907 Promotion an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg
Zulassung als Anwalt am Amtsgericht Bochum
31.3.1933 Erlass des Reichskommissars für das Justizwesen Hanns Kerrl
April 1933 beurlaubt als Landsgerichtsrat in Bochum; die vier am Landgericht und Amtsgericht tätigen jüdischen Richter: Landgerichtsdirektor Leo Nachmann, Landgerichtsrat Dr. Siegmund Loewenstein, Landgerichtsrat Alfred Cosmann und Amtsgerichtsrat Robert Samuelsdorff, wurden im April 1933 beurlaubt. Von den 22 jüdischen Rechtsanwälten wurden zehn Anwälte sofort mit Berufsverbot belegt. In den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ums Leben gekommen sind: Landgerichtsdirektor Leo Nachmann, die Rechtsanwälte Dr. Hugo Freudenberg, Dr. Siegmund Loewenstein, Dr. Josef Meyersberg, Dr. Wilhelm Rosenbaum und Gerichtsreferendar Josef Rosenthal.
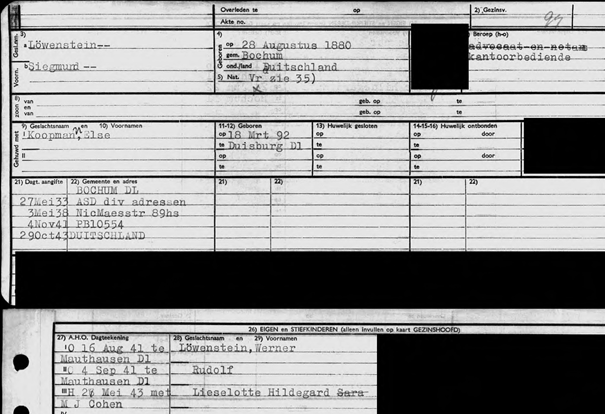
27.5.1933 Flucht nach Amsterdam, Niederlande; kann dort nur als Büroangestellter arbeiten
21.11.1933 Ehefrau Else aus Bochum in Amsterdam gemeldet
31.10.1939 Aberkennung des akademischen Grades Dr. jur. durch die Universität Heidelberg
14.5.1941 Bombenexplosion im Marine-Offiziersclub Amsterdam ist Anlass für Verhaftungswelle
11.6.1941 SS-Obersturmführer Klaus Barbie von der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam“ erschleicht sich durch Täuschung die Adresslisten der „Werkdorper“
11.6.1941 die Söhne Werner und Rudolf bei Razzia verhaftet, als „Vergeltungsmaßnahme“ 300 Jugendliche, davon 61 „Werkdorper“ im Durchgangslager Schoorl inhaftiert
Von den „Werkdorpern“ werden 4 freigelassen, 57 in das KL Mauthausen deportiert,
Keiner der nach Mauthausen Deportierten überlebt das Jahr 1941
16.9.1941 Tod des Sohnes Werner in Mauthausen
4.9.1941 Tod des Sohnes Rudolf in Mauthausen
1942 Zunächst vom Joodse Raad gesperrt vor Transport
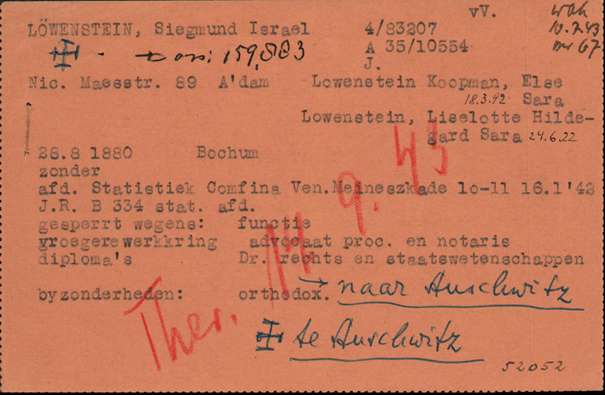
10.7.1943 Deportation nach Westerbork
17.7.1943 Antrag auf „Palestina verklaring“ (Bruder der Frau in Palästina) wird abgelehnt
20.6.1943 Tochter Lieselotte nach Westerbork
14.9.1943 Deportation mit der Ehefrau Else ins Sternlager Bergen-Belsen
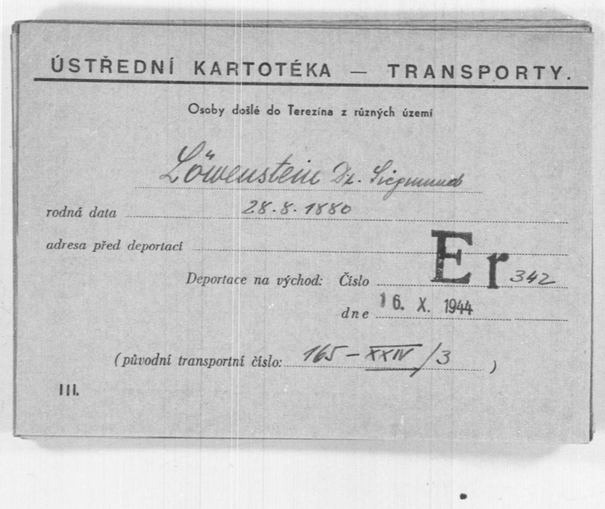
25.1.1944 Transport XXIV/3 nach Theresienstadt
16.10.1944 Transport Er von Theresienstadt nach Auschwitz
18.10.1944 Tod in Auschwitz
Quellen
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919887
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919994
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de919952
https://www.bochum.de/Stadtarchiv/Station-9-Justizbehoerden
Hilmar Schmuck (Hrsg.), Gesamtverzeichnis deutschsprachigen Schrifttums 1700-1910
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22L%C3%B6wenstein%201880%22
https://archief.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Koopmann%201892%22%7D
https://collections.arolsen-archives.org/search/?s=Cohen%201922
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11585188&ind=1
Hubert Schneider, Schicksale der Richter jüdischer Herkunft am Amts- und Landgericht Bochum
Hubert Schneider, Die Entjudung des Wohnraums: Judenhäuser in Bochum; Münster, 2010
Hubert Schneider, Leben nach dem Überleben; LIT-Verlag 2014
Gedenkbuch der Opfer der Shoa aus Bochum und Wattenscheid, 2000
Manfred Keller, Spuren im Stein, ein Bochumer Friedhof als Spiegel jüdischer Geschichte, 1997