Adolf Adi Abraham Lindenbaum
*6.6.1921 in Hanover; ✡ 1993
Staatsangehörigkeit deutsch
Religion jüdisch
Vater Jakob Lindenbaum *20.6.1889 in Dolina, Galizien; ✡ 4.4.1945 in Buchenwald
Heirat der Eltern 21.7.1920 in Hannover
Mutter Selma Sura Lindenbaum *2.11.1895 in Dolina; ✡ ?1942/43 in Riga
Großvater Salomon Shlomo Lindenbaum *15.12.1867 in Dolina; ✡ 22.12.1952 Ranatayim Israel
Großmutter Jitta Bohnum Erster *3.1.1870 in Spas, Galizien; ✡29.12.1930 in Hannover
Onkel Otto Osias Lindenbaum *18.6.1892 in Dolina; Unna; ✡Majdanek; oo Freide Turtelbaum
Tante Toni Schweizer geb. Lindenbaum *26.3.1907 in Hannover; oo Paul Schweizer
Tante Leah Strassmann geb. Lindenbaum * 6.10.1903 in Hannover; ✡ 13.5.1945 in Neustadt bei Lübeck; oo Samuel Strassmann (1901-1943 in Riga)
Geschwister –
Leo Lindenbaum *22.3.1923 in Hannover; ✡ ?vor 1945 in Polen
Beruf landwirtschaftlicher Praktikant
Adressen Hannover, Bergmannstraße 10;
Heirat –
Kinder –
Weiterer Lebensweg
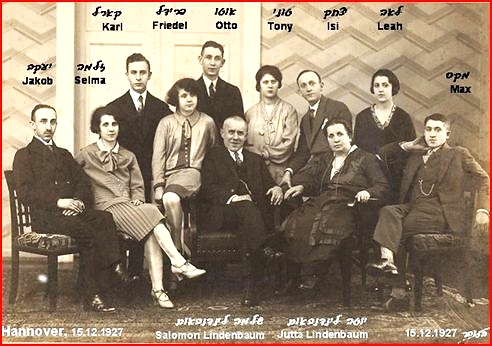
15.12.1927 60. Geburtstag des Großvaters in Hannover
Tante Leah Strassmann geb. Lindenbaum wohnte bis 1933 in Recklinghausen
1937 Gärtnerlehrling in der Israelitischen Gartenbauschule Hannover Ahlem
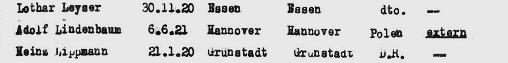
3.6.1937 in der Belegungsliste der Israelitischen Gartenbauschule als Externer geführt
Die erste Polenaktion
28.10.1938 Bruder Leo, Onkel Otto Osias und Tante Toni abgeschoben nach Zbaszyn; beide Eltern und Tante Toni später in Tarnow, Wehrmachtstraße 2, Galizien
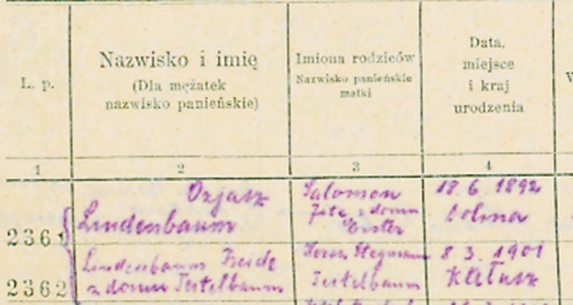
Registrierung von Onkel Ozjasz und Freide Lindenbaum in Zbaszyn
17.5.1939 beide Eltern in Hannover bei Minderheiten-Volkszählung
Die zweite Polenaktion
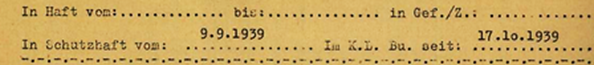
9.9.1939 Verhaftung mit dem Vater Jakob durch die Gestapo Hannover als „feindlicher Ausländer“

17.10.1939 Internierung mit dem Vater als polnischer Jude im KL Buchenwald,
Unterbringung im Judenblock Nr 22; Arbeitskommando Gärtnerei
Er gibt zunächst seine Mutter in Hannover, später seine Tante Toni Schweizer in Tarnow, Wehrmachtstraße 2 als Verwandte an
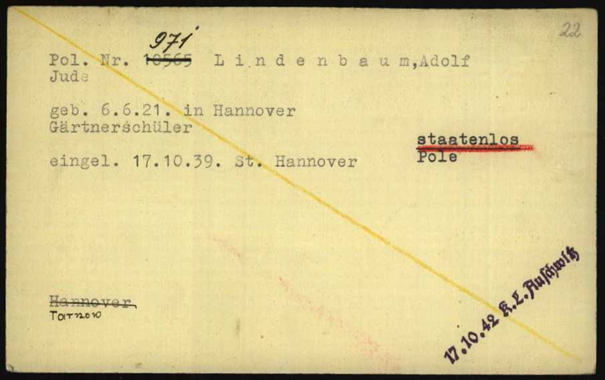
16.10.1942 Überstellung von 500 polnischen Häftlingen aus Buchenwald in das KL Ausschwitz zum Aufbau des Buna-Werks in Auschwitz Monowitz; auf diesem Transport befinden sich auch Abraham Matuszak, Adi Lindenbaum, Jakob Zylbersztajn und Heinrich Tydor
Vater Jakob verbleibt im KL Buchenwald, wo er am 4.4.1945 umkommt
17.10.1942 Adi Lindenbaum eingewiesen in Auschwitz III zum Aufbau des IG-Farben Werkes Buna Monowitz, auf LKW in die Quarantäneblöcke des „Arbeitslager Buna“ gebracht; Tätowierung der „nichtarischen“ Häftlinge;
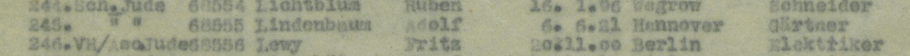

ihm wird die Auschwitz-Häftlingsnummer 68555 in den linken Unterarm tätowiert.
1944 Adi Lindenbaum hilft Sophie Manela, später Ester Pur im Auschwitz-Außenlager Rajsko bei der Beschaffung von Zivilkleidung für ihre Flucht; Ester Pur berichtet:
„Bis eines Tages einer der Jungen aus dem Lager kam, sein Name war Adi Lindenbaum, der auch in der Hachschara-Ausbildung (Gartenbauschule Ahlem FJW) war – ich kannte ihn nicht, er war aus einer älteren Klasse, er kam zu meinem Gewächshaus in Rajsko und transportierte Pflanzen dorthin, Auschwitz und dann Rückkehr ins Lager. Ich sagte zu ihm: Schau, Eva hat mir gesagt, es ist ausgemacht, dass es einen Fluchtplan gibt, was denkst du, kannst du uns helfen? Etwas zum Mitbringen, damit wir selbst Kleidung nähen können. Denn das, was wir trugen, waren Kleidungstücke mit Lagerstreifen. Also sagt er: Ich werde es dir bringen. Und er brachte eine Decke, zwei Hemden und eine Hose mit. Und wir haben es versteckt, wir haben gesagt: Eva, was denkst du, vielleicht denken wir darüber nach, wie wir fliehen können Und sie sagte: Vielleicht.„
5.1.1945 Sophie und Eva gelingt die Flucht aus dem Außenlager Rajsko
18.1.1945 Evakuierung aller drei Auschwitz-Lager; ca 10 000 Häftlinge aus Monowitz auf dem Todesmarsch über 42 km von Monowitz nach Nikolai;
Isidor Philipp berichtet:
„Theo Lehmann und ich schleppten einen Häftling, einen schwachen jungen Mann, bis Gleiwitz mit. 80 km im tiefen Schnee. Wer sich hinlegte, wurde von den SS-Männern, die auf Motorrädern mit Beiwagen fuhren, erschossen.“
Übernachtung in einer Ziegelei in Nikolai, weitere 25 km bis nach Gleiwitz
21.1.1945 Aufteilung auf verschiedene Transporte
Philipp mit 4000 Häftlingen von Gleiwitz in offenen Güterwaggons Irrfahrt über Tschechien, nach Mauthausen und wieder nach Deutschland
„Von dort begann dann – in offenen Kohlewaggons und bei 15 Grad unter Null – die Fahrt durch Polen, Tschechoslowakei und Österreich zurück nach Deutschland.“
28.1.1945 Ankunft von 3500 Häftlingen, 500 Toten Nordhausen KL Mittelbau Dora bei Nordhausen, unterirdische Flugzeug- und V2-Raketenfabrikation
Zwei Tage nach Ankunft waren weitere 600 Häftlinge tot;

Nach Auflösung von Dora nach Ravensbrück
14.4.1945 Ankunft im überfüllten Frauen-KL Ravensbrück; Unterbringung im Jugendlager Uckermarck
24.4.1945 nach Weitertransport Ankunft im Auffanglager Wöbbelin, das Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme; es bestand als Auffanglager nur zehn Wochen, vom 12. 2 bis zum 2. 5.1945;
2.5. 1945 Befreiung im Lager Wöbbelin, die SS-Wachen fliehen nach einem Luftangriff

23.6.1945 Entlassung aus dem KL Buchenwald durch alliierte Kommission

30.10.1945 DP Camp Zeilsheim
März 1946 mit 736 Maapilim auf der SS TEL HAI illegal von Marseille nach Haifa;
vor Haifa wird das Schiff von der britischen Marine aufgebracht und übernommen;
die TEL HAI war das letzte Einwandererschiff, welches von den Briten an Land gelassen wurde.

28.3.1946 nach Ankunft in Haifa zunächst im Hafengelände eingesperrt
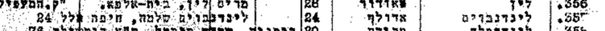
Internierung im britischen Internierungscamp Athlith
Deportation der Mutter nach Riga
3./4.9.1941 „Aktion Lauterbacher“, Zwangsumzug der Mutter Sura ins Juden-Ghettohaus, Hannover, Josephstraße 22, wo auch ihre Schwägerin Leah Strassmann geb. Lindenbaum sowie Anna Levy geb. Bauer aus Castrop und Selma Sollinger aus Iserlohn zwangseingewiesen werden.
November 1941 Deportationsbescheid der Gestapo
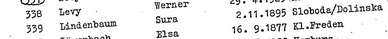

15.12.1941 morgens Verbringung per Lastwagen aus den Judenghettohäusern über seit Anfang November 1941 von der Gestapo zur Sammelstelle umfirmierte Israelitische Gartenbauschule zum Bahnhof Fischerhof in Hannover-Linden
Bahnfahrt in Personenwagen mit angehängten Gepäckwagen der Deutschen Reichsbahn in das Ghetto Riga vom Bahnhof Fischerhof in Hannover-Linden nach Riga Skirotawa zusammen mit 999 anderen Hannoveraner Juden
18.12.1941 Ankunft der Mutter und Tante Leah in Riga, Rangierbahnhof Skirotawa, Fußmarsch ins Ghetto Riga
4.4.1945 Tod des Vaters in Buchenwald
Gedenken
–
Quellen
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916254
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1488944
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916259
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de1002579
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de978310
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/68060475
https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de916261
Ester Pur, Autobiografie, in: Zeugnisse aus dem Tal des Todes, Oranit, 1996
Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939
https://www.mappingthelives.org
Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten
Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947
https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf
Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.
https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13
Ezra Ben Gershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989
Joel König (Ezra Ben Gershom), Den Netzen entronnen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1967
Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328
Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988
Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/68060475
https://www.mappingthelives.org
Staatsarchiv Israel, Einwanderungslisten
Mandat zur Einbürgerung in Palästina, 1937-1947
https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13.pdf
Bettina L. Götze, Landwerk Steckelsdorf-Ausbau, in: Hachschara als Erinnerungsort.
https://hachschara.juedische-geschichte-online.net/ort/13> [24.03.2024]
Ezra Ben Gershôm David. Aufzeichnungen eines Überlebenden, Evangelische Verlagsanstalt 1989
Joel König (Ezra Ben Gershom), Den Netzen entronnen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1967
Bettina Götze, Rathenow, in: Irene Annemarie Diekmann (Hrsg.), Jüdisches Brandenburg. Verlag für Berlin-Brandenburg 2008. S. 304–328
Jizchak Schwersenz: Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland. Berlin: Wichern Verlag 1988
Michael Wermke: Ein letztes Treffen im August 1941. Kurt Silberpfennig und die Praxis religiös-zionistischer Pädagogik, Jüdische Bildungsgeschichte in Deutschland. Münster: Waxmann 2020
Anneliese Ora-Borinski, Erinnerungen 1940 – 1943, Kwuzat Maayan-Zwi, Israel 1970